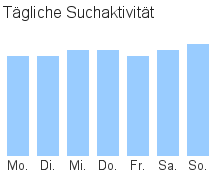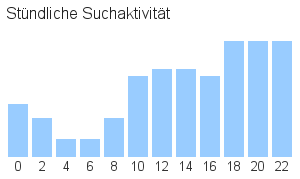Marius Melzers Lobpreis von Linux und quelloffener (d. i. Open-Source-)Software allgemein in der Liveveranstaltung vom letzten Dienstag hat für einigen Wirbel gesorgt: Dem SOOC-Teilnehmer problembaum alias Herr Fuchs war er Stein des Anstoßes zum Testen und letztlich zur Nutzung einer Linuxdistribution auf seinem älteren Schlepptop, und der SOOC-Mitorganisator Michael Winkler verfasste einen zusammenfassenden Beitrag zum Thema auf dem SOOC-Hauptblog. Da ich mich seit erst einigen Wochen zu den Linuxbenutzern und auch -verfechtern zähle, möchte ich hier meine Sicht der Dinge darlegen und einige Aussagen Michaels und Marius‘ näher unter die Lupe nehmen. Kurzum: Warum Linux eben doch besser ist. 😉
Linux ist meiner Meinung nach nicht besser und nicht schlechter als Windows (7/8). (Zitat von Michael Winkler)
Von „besser“ oder „schlechter“ kann man pauschal nicht sprechen, man kann jedoch durchaus Aussagen darüber machen, in welcher Hinsicht Linux dem althergebrachten Windows das Wasser reichen kann oder eben sogar überlegen ist.
Einer dieser Bereiche ist der der Sicherheit, den meinem Verständnis nach auch Marius in der Liveveranstaltung im Hinterkopf hatte, als er Linux lobte. Aber ist Linux denn wirklich sicherer, was Viren, Trojaner, Würmer und ähnliche Schadsoftware angeht? Ja, und zwar hauptsächlich aus zwei Gründen: Erstens ist Windows natürlich das mit Abstand am weitesten verbreitete Betriebssystem für Endanwender, es lohnt sich also schlichtweg viel mehr, Schadsoftware für Windows zu erstellen. Zweitens werden alle Linuxdistributionen dadurch, dass sie quelloffen sind, ständig von vielen Einzelnen kontrolliert und verbessert, wodurch Sicherheitslücken viel schneller entdeckt und geschlossen werden können – anders als bei Windows, wo der Flickenteppich zwar immer mal durch Sicherheitsupdates und Patches ausgebessert wird, aber keiner den Überblick behält. (Hier gibts weiterführende Informationen zum Thema Sicherheit für Ubuntu, das in dieser Hinsicht exemplarisch für alle größeren Linuxdistributionen stehen kann.)
Ein anderer Bereich, der für viele von Interesse ist, ist die Performance: Jeder will natürlich, dass sein Computer flüssig und möglichst schnell läuft, ein älterer Laptop wie bei problembaum zum Beispiel darf nicht schon vom Betriebssystem allein überlastet werden. Dazu möchte ich erzählen, wie ich zu Linux gekommen bin. Seit ich meinen nun über vier Jahre alten Schlepptop besaß, arbeitete ich mit Windows XP Pro, einem sehr soliden Betriebssystem ohne allzuviel Schnickschnack, bei dem man nicht benötigten Quark auch (im Verhältnis zu Windows Vista) gut deaktivieren kann. Leider bin ich ein Mensch, der seinen Computer recht aktiv und vielfältig nutzt und gern die vielen Programme ausprobiert, die einem das Internet so entgegenwirft – so ein Verhalten wurde mir unter Windows damit quittiert, dass immer nach einem halben bis dreiviertel Jahr der Laptop derart langsam wurde, das er kaum mehr verwendbar war. Meine Problemlösung bestand darin, Windows eine eigene Festplattenpartition zu widmen, sodass ich denn also alle dreiviertel Jubeljahre mein Betriebssystem neu installierte und jedes Mal etwa einen Tag beschäftigt war, bis wieder alle nötigen Programme eingerichtet und Windowseinstellungen getätigt waren. Das ging gut so, bis Mitte Oktober. Da nämlich bekam ich Wind davon, dass der Support für Windows XP im Frühjahr 2014 ausläuft – das bedeutet im Klartext, dass es dann keine neuen Sicherheitsupdates mehr gibt und das System von Tag zu Tag unsicherer wird. An diesem Punkt wurde mir klar, dass der Umstieg auf ein anderes Betriebssystem unausweichlich war. Zunächst hatte ich da Windows 7 im Blick, denn Windows 7 benötigt etwas weniger Ressourcen als Windows Vista. Doch dann der Schock: Bei Notebooks ist Windows 7 langsamer als das acht Jahre ältere Windows XP. Moment, wie bitte? Ich kaufe ein neues, aktuelles Betriebssystem, bezahle ne Menge Geld dafür, und es ist dennoch langsamer als mein vorheriges A. D. 2001? Für wie blöd halten die mich denn, was soll das? Diese Information hat mir die Lust auf einen Umstieg auf Windows 7 derart vermiest, dass ich mich nach Alternativen umgesehen habe. Mit dem Gedanken, mal Linux auszuprobieren, hatte ich schon länger gespielt, doch der innere Schweinehund hatte bisher immer gewonnen. Nun jedoch erkannte er seine Chance und brachte mich dazu, mich einen Tag (wie jahrelang für die Windows-Neuinstallation) umfassend über Linux zu informieren. Am Abend war es vollbracht: Ich hatte verschiedene Linuxdistributionen ausprobiert und mich für Kubuntu entschieden. Dann ging alles recht schnell: Dateien extern sichern und einen USB-Stick zum Kubuntu-Installationsstick machen. Dann startete ich die Installation und binnen einer halben Stunde war ich schon kräftig am Rückkopieren meiner Daten auf mein neues System. Es dauerte ca. eine Woche, bis ich alle Fragen und Probleme geklärt und beseitigt hatte, aber es war nicht kompliziert, und es sind wirklich an nirgendwo Inkompatibilitäten aufgetreten. Zurück zum Thema Performance: Mein nicht mehr ganz neuer Laptop läuft noch etwas schneller als er es nach einer nigelnagelneuen Windows-XP-Installation stets getan hat. Ein erneutes Zumüllen des Systems mit temporären Dateien und Resten deinstallierter Programme ist aufgrund der anders gearteten Architektur von Linux ausgeschlossen (siehe z. B. hier und hier).
Ein weiteres Thema das viele umtreibt ist die Kompatibilität: Linux funktioniert ganz anders als Windows, in der Konsequenz laufen Windowsprogramme unter Linux nur unter bestimmten Bedingungen. Müssen sie das aber? Nein, wie ich mich belehren lassen musste, müssen sie das keineswegs – viele benutzen schon jetzt quelloffene Software, auf die auch Marius ja eingegangen ist, wie Firefox, Thunderbird und LibreOffice. Für diese gibt es, weil ihr Programmcode ja frei verfügbar ist, stets auch Linuxvarianten, im Falle der erwähnten weitverbreiteten Programme oft sogar bereits integriert in den Distributionen. Für alle sonstigen Programme, die man unter Windows benutzt hat, gibt es Linuxprogramme mit gleicher Funktionionalität – sollte man doch einmal auf eine der seltenen Ausnahmen stoßen, bei denen es (noch) kein Linuxprogramm als Ersatz gibt, gibt es noch die Möglichkeit der Emulation: Einem Programm wird quasi ein Windowssystem vorgetäuscht. Mit diesem Trick habe ich sogar ein wirklich sehr spezielles Programm zur Programmierung einer Flugmodellfernsteuerung unter Linux zum Laufen gebracht. Ergo: Man sollte sich im Klaren darüber sein, dass man proprietäre Programme wie z. B. MS Office (Word, Excel etc.) unter Linux nur mit großen Performanceeinbußen betreiben kann und deshalb besser beraten ist, auf quelloffene Alternativen wie z. B. LibreOffice umzusteigen. Diese bieten gewöhnlich dieselben Funktionen in einer oft nicht sehr anderen Aufmachung und sind neben den von Marius aufgeführten Vorteilen obendrein kostenlos.
Einen Bereich möchte ich noch ansprechen, weil er für mich doch einige Relevanz besitzt: die Individualisierbarkeit. Für Windows gibt es verschiedene Themen, in denen man außerdem einige Einstellungen wie Fensterfarben und in gewissem Maße die Schriftformatierung beeinflussen kann. Unter Linux kann man seine gesamte graphische Oberfläche wechseln oder sogar verschiedene in einem System betreiben. Wie unter Windows gibt es für jede eine Vielzahl von Themen, die man allerdings viel ausgiebiger anpassen kann: Kontrollleisten lassen sich verschieben und die Anzeige genau auf die eigenen Bedürfnisse abstimmen. Des weiteren lassen sich die verwendeten Schriften vollständig anpassen, was sich im Falle meines sehschwachen Vaters als nicht mit Gold aufzuwiegen herausgestellt hat: Mit Linux konnte er die Elemente seines Desktops an seine Bedürfnisse von Größe und Kontrast anpassen, ohne wie unter Windows mühsam mit der Bildschirmauflösung herumspielen zu müssen. Was ich hochschätze: Wenn eine Einstellung mal nicht über die Menüs verfügbar ist, habe ich immer noch die Möglichkeit, mir den Code des jeweiligen Themas anzusehen und Änderungen direkt dort vorzunehmen – weil er offen ist.
Verfügbare Hilfe nenne ich den letzten Bereich, den ich in diesem schon fast zu ausführlich gewordenen Blogpost besprechen will. Linux wird von vielen vielen Menschen weiterentwickelt, und entsprechend gibt es eine riesige Gemeinschaft von Nutzern, die sich in Foren und Wikis organisiert. Man kann getrost davon ausgehen, dass es kein Problem gibt, was nicht ein anderer schon mal gehabt hätte – ich habe in den letzten Wochen auf wirklich jede meiner teilweise recht komplexen Fragen Antwort und Hilfe gefunden. Diese Gemeinschaft, die ständige Besprechung von Problemen und eventuellen Fehlern, trägt ihrerseits in nicht unerheblichem Maße zur Weiterentwicklung der Distributionen bei. Gerade als Um- und Neueinsteiger kann man sich darauf verlassen, dass einem Hilfe zuteil wird, wenn man irgendwo auf ein Problem stößt.
Fazit: Nach ca. sechs Wochen mit der Linuxdistribution Kubuntu auf meinem Laptop kann ich nur sagen, dass ich begeistert bin: Viele der alten Probleme und Inkompatibilitäten, mit denen Windows immer wieder nervte, haben sich in Luft aufgelöst, und jegliche neuen Probleme waren nach etwas Recherche schnell und einfach lösbar. Das neue System läuft schneller und zuverlässiger als Windows XP und sieht exakt so aus, wie ich es haben möchte.
 Als Programm zum Sammeln und Organisieren der einzelnen gescannten Seiten habe ich gscan2pdf entdeckt, ein ganz wunderbares Programm, mit dem man die gescannten Seiten auch sehr leicht beschneiden, drehen (oder gleich beim Scan automatisch drehen lassen) und sortieren kann. Des weiteren ist es in gscan2pdf problemlos möglich, andere PDF- oder Bilddateien wie JPGs oder PNGs als Seiten einzufügen, sodass man auch bereits erstellte PDF-Dateien bearbeiten kann. Nicht zuletzt bietet das Programm verschiedene Methoden der Texterkennung an, ich habe tesseract-ocr genutzt und war überrascht: Die Texterkennung erkennt wirklich fast alle und selbst schlecht gedruckte Wörter völlig korrekt! In jedem Fall reicht der Grad der Erkennung für das Durchsuchen der PDF-Datei nach Stichwörtern völlig aus, auch wenn bisweilen mal ein Komma als Punkt erkannt wird. Was dabei rauskommt: Eine durchsuchbare PDF-Datei, der man absolut nicht ansieht, dass sie mit recht simplen Mitteln eingescannt wurde.
Als Programm zum Sammeln und Organisieren der einzelnen gescannten Seiten habe ich gscan2pdf entdeckt, ein ganz wunderbares Programm, mit dem man die gescannten Seiten auch sehr leicht beschneiden, drehen (oder gleich beim Scan automatisch drehen lassen) und sortieren kann. Des weiteren ist es in gscan2pdf problemlos möglich, andere PDF- oder Bilddateien wie JPGs oder PNGs als Seiten einzufügen, sodass man auch bereits erstellte PDF-Dateien bearbeiten kann. Nicht zuletzt bietet das Programm verschiedene Methoden der Texterkennung an, ich habe tesseract-ocr genutzt und war überrascht: Die Texterkennung erkennt wirklich fast alle und selbst schlecht gedruckte Wörter völlig korrekt! In jedem Fall reicht der Grad der Erkennung für das Durchsuchen der PDF-Datei nach Stichwörtern völlig aus, auch wenn bisweilen mal ein Komma als Punkt erkannt wird. Was dabei rauskommt: Eine durchsuchbare PDF-Datei, der man absolut nicht ansieht, dass sie mit recht simplen Mitteln eingescannt wurde.